Startseite
Herzlich willkommen zur multimedialen Webseite Protest (er)zählt!Erlebe eine Zeitreise zu Protesten und Protestbewegungen im geteilten Deutschland und der Tschechoslowakei.
Tauche mit uns ein in verschiedene Protestbewegungen: An drei Schauplätzen lernst du je einen Protest in der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und der Tschechoslowakei kennen. Die verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Umstände dieser Staaten machen jede dieser Bewegungen in Bezug auf Auslöser und die Umsetzung einzigartig. Du kannst also mehr über die Ursachen, Mechanismen und Formen von Widerstand lernen.
Von dieser Startseite aus kannst du die einzelnen Schauplätze betreten. Hier findest du jeweils eine Infobox mit einem einführenden Comic und einer Einführung in den historischen Kontext. Durch Scrollen oder Wischen kannst du diese aufrufen.
Anschließend kannst du die einzelnen Elemente anklicken. So öffnen sich weitere Informationen über Ursachen, Auswirkungen oder Beteiligte zu den einzelnen Protesten. Die Elemente sind mit Markern versehen. Du findest sie, indem du mit der Maus oder dem Finger über den Bildschirm fährst. Sie leuchten auf, wenn diese/r auf ihnen liegt. Die Videos, Fotos, Abbildungen, Grafiken etc. auf diesen Unterseiten kannst du ebenfalls anklicken und anschauen.
Hast du das Ende einer Unterseite erreicht, gelangst du automatisch zurück zur Startseite. Du kannst dich aber auch jederzeit über das Navigationsfeld am rechten Bildrand selbstständig dort hinbewegen.
Wenn du nicht am Computer sitzt, drehe dein Tablet oder Smartphone ins Querformat für eine optimale Ansicht.
Und jetzt: Viel Spaß beim Erkunden!
Impressum
Hier findest du das Impressum.
Datenschutz
Hier findest du Informationen zum Datenschutz.
Historische EInführung
Zum Anfang17. Juni 1953 - Vom Arbeiterstreik zum Volksaufstand in der DDRHistorische Einführung
Im Jahr 1949 wurde auch die DDR als Staat gegründet, nachdem Joseph Stalin persönlich dafür grünes Licht gegeben hatte. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, in der ein marktwirtschaftliches System entstand, bereitete die SED-Führung in der DDR die Einführung der Planwirtschaft vor. Die Ausgangsvoraussetzungen der Wirtschaft waren in der DDR besonders schwierig, weil die Sowjetunion in großem Ausmaß Industrieanlagen als Reparationen demontierte und ins eigene Land abtransportierte. Die wirtschaftliche Entwicklung in den beiden deutschen Staaten verlief somit sehr unterschiedlich.
Nach ersten Schwierigkeiten wuchs in der Bundesrepublik die Wirtschaft kontinuierlich. Lebensmittelkarten, mit denen bestimmte Produkte rationiert wurden, wurden in der Bundesrepublik 1950 abgeschafft. In der DDR erhielt die Schwerindustrie Vorrang beim Wiederaufbau; Lebensmittelkarten wurden hier erst 1958 abgeschafft. Großen Unmut in der Bevölkerung erregte die Entscheidung der SED-Führung im Jahr 1952, den Sozialismus „planmäßig“ einzuführen. Die mit dieser Entscheidung verbundenen Zwangsmaßnahmen brachten große Teile der Bevölkerung gegen die Partei- und Staatsführung auf. Die Erhöhung der Arbeitsnormen war schließlich der Zündfunke, der im Juni 1953 einen Volksaufstand in der DDR auslöste.
Was waren Ursachen und Auslöser des Volksaufstands 1953?
Was waren Ursachen und Auslöser des Volksaufstands 1953?Die SED verfolgt unerbittlich ihr Ziel: Die Einführung des Sozialismus in der DDR
Der Entscheidung zum Aufbau des Sozialismus im Jahr 1952 folgten Verstaatlichungen von Betrieben, Zwangskollektivierungen in der Landwirtschaft und weitere Repressalien. Diese Maßnahmen kamen einem Kampf gegen große Teile der Bevölkerung gleich, die angesichts des weiter bestehenden Mangels an Gütern des täglichen Bedarfs kein Verständnis dafür hatte.
1. Die 2. Parteikonferenz der SED 1952 - planmäßiger Aufbau des Sozialismus
Um die Staatsmacht zu stärken, versuchte man bei der 2. Parteikonferenz den Aufbau nationaler Streitkräfte voranzutreiben. Tatsächlich aber war die Konferenz inszeniert, da sie kein Parlament darstellte. Eine Beschlussfassung besaß sie faktisch nicht. Mitte 1953 verfügte die Kasernierte Volkspolizei (KVP), der Vorläufer der Nationalen Volksarmee, bereits über 110.000 Bewaffnete. Mit großen wirtschaftlichen Anstrengungen (Erhöhung der Arbeitsproduktivität und Senkung der Selbstkosten) sollte innerhalb kurzer Zeit der Lebensstandard auf Vorkriegsniveau gebracht werden.
2. Die wirtschaftliche und politische Situation der DDR

Der wirtschaftliche Aufschwung wurde zusätzlich gebremst durch die Zwangsmaßnahmen bei der Einrichtung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) und gegenüber Selbstständigen. Viele Menschen wollten ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben und flüchteten in die Bundesrepublik. Da zudem viele Menschen in die Kasernierte Volkspolizei eingezogen wurden, hatten die Betriebe in allen Branchen Probleme Arbeitskräfte zu finden. Innerhalb eines kurzen Zeitraums mussten die Betriebe dadurch ab 1952 auf rund 60.000 junge Männer als Arbeitskräfte verzichten.
Neben der Wirtschaft sollten alle Lebensbereiche den Vorstellungen der SED entsprechend organisiert werden. Die Länder wurden abgeschafft und stattdessen elf Bezirke eingerichtet. Das Rechtswesen wurde umgestaltet, das Bildungssystem sollte reformiert werden. 1952/1953 begann die SED ihren Kampf gegen die Kirchen, insbesondere gegen die Evangelische Kirche. Die Kirchen waren die letzten eigenständigen Großorganisationen in der DDR. Der evangelischen Jugendorganisation „Junge Gemeinde“ wurde vorgeworfen, als „Tarnorganisation für Kriegshetze, Sabotage und Spionage“ im Auftrag des Westens aktiv zu sein. Viele Jugendliche und Theologen wurden verhaftet.
Der Unmut in der Bevölkerung wuchs, was auch an der steigenden Zahl von Geflüchteten abzulesen war, die in die Bundesrepublik übersiedelten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Ein Arbeiter lehnt sich an das Geländer eines Turmdrehkrans.
3. Die Erhöhung der Arbeitsnormen
Ende 1952 kam es dann zu einer ersten regelrechten Streikwelle, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter mit der Höhe der Prämien und Weihnachtsgeldzahlungen nicht einverstanden waren. Trotz der wachsenden Unzufriedenheit in den Betrieben beschloss das Zentralkomitee der SED am 14. Mai 1953 die Erhöhung der Arbeitsnormen um 10 Prozent zum 1. Juni 1953.
Die Normen heraufzusetzen, bedeutete faktisch eine Lohnkürzung: In der gleichen Zeit musste mehr geleistet werden. Gegen diese Entscheidung wuchs der Widerstand in den Betrieben. Es kam immer wieder zu Arbeitsniederlegungen.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Artikel 14 der DDR-Verfassung von 1949
(Quelle: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0232_ddr_de.pdf)
4. Der Tod Stalins und die Folgen
Angesichts des neuen Kurses in der Sowjetunion befürchtete die SED-Führung zunehmenden Widerstand gegen ihre Politik und reagierte mit Härte auf erste Proteste; die SED-Führung sah keinen Anlass, ihren eingeschlagenen Weg zu korrigieren. Es waren die Sowjetunion, der deutlich wurde, dass der rasche Aufbau des Sozialismus in der DDR große Probleme bereitete. Ein deutliches Indiz waren die steigenden Flüchtlingszahlen: allein im März 1953 flohen 31.000 Menschen aus der DDR. Die Sowjets setzten eine Kommission ein, die Vorschläge zur Verbesserung der Situation in der DDR ausarbeitete. Es wurde eine hochrangige SED-Abordnung mit Walter Ulbricht, dem SED-Generalsekretär, an der Spitze nach Moskau einbestellt.
Während des Aufenthaltes wurden der Delegation „Maßnahmen zur Gesundung der politischen Lage“ präsentiert. Dazu gehörten u. a.: Rücksichtnahme auf die Einstellung der Bauern bei der Zwangskollektivierung, Stärkung bäuerlicher Wirtschaften, Förderung von Privatkapital und Privatunternehmen, Änderung des Fünfjahresplans zur Stärkung der Konsumgüterindustrie, Abkehr von der Bevorzugung der Schwerindustrie sowie die Einstellung des Kampfes gegen die Kirchen.
Nach anfänglichem Widerstand akzeptierte die vollkommen überraschte Delegation der SED die ihnen auferlegten Kurskorrekturen. Nach der Rückkehr bereitete die SED-Führung in wenigen Tagen hektisch Maßnahmen vor, um die Instruktionen umzusetzen. Schließlich veröffentlichte die SED-Führung am 9. Juni 1953 ein Kommuniqué, das am folgenden Tag im Radio gesendet und am 11. Juni auf der Titelseite des „Neuen Deutschland“, dem Parteiorgan der SED, veröffentlicht wurde. Darin kündigte die SED eine politische Kurskorrektur an und gestand ein, Fehler gemacht zu haben – allerdings ohne zu erwähnen, dass die Kurskorrektur auf Anweisung aus Moskau erfolgte.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Persönliche Notizen von DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl vom 2. Juni 1953. Er notierte sich die Namen der Gesprächspartner und die Kernaussage der Besprechungen: "Beunruhigt über DDR, Dokument über Maßnahmen zur Genesung. Verbesserung d. Ökonomie. 10.0 am 3.6. Fortsetzung. Wilhelm [Pieck] am 4.6. Berichtet."
Quelle: Bundesarchiev: BArch, NY 4090/699 Bl. 30.
5. Die Kurskorrektur der SED kommt zu spät
Rücknahme
- der Einschränkungen in der Lebensmittelversorgung,
- der Zwangskollektivierungen,
- der drastischen Steuererhebungen.
Da die SED versäumte, konkrete Handlungsanweisungen zur Umsetzung des neuen Kurses für die einzelnen Parteigliederungen auszugeben, kam es zu Unsicherheiten und Verwirrungen bei den SED-Mitgliedern. Parteifunktionäre, die den harten Kurs der Partei bei der Einführung des Sozialismus vehement verteidigt hatten, waren fassungslos und wurden öffentlich angefeindet. Die Bevölkerung wertete den Richtungswechsel als Bankrotterklärung der SED. Zudem fehlte ein wichtiger Punkt bei den angekündigten Veränderungen: die Normerhöhung wurde nicht zurückgenommen. Das sollte der Zündfunke für das Aufflammen von Auseinandersetzungen werden.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht Volkes Wille“ – diese Parole auf einem Straßenbahnwagen in Leipzig am 17. Juni 1953 spielte auf die führenden SED-Politiker Ulbricht, Pieck und Grotewohl an.
Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, 13782 Sammlung Bewegtbilder, Nr. AV 13782-102
17. Juni 1953 - Vom Arbeiterstreik zum Volksaufstand in der DDR
Zur Startseite
Wie verlief der Volksaufstand?
Wie verlief der Volksaufstand und mit welchen Mitteln wollten die Beteiligten Veränderungen erreichen?Aus Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen entwickelt sich ein Volksaufstand
1. Der Beginn des Aufstandes in Berlin
Unter den Bauarbeitern der Stalinallee und auf umliegenden Großbaustellen gab es schon vor dem 17. Juni Unruhen. SED-Funktionäre versuchten die aufgebrachten Arbeiter zu besänftigen, was aber nicht gelang. Bereits am 15. Juni weigerten sich die Bauarbeiter des Krankenhauses Friedrichshain, ihre Arbeit aufzunehmen. Sie forderten die Rücknahme der Normerhöhungen und richteten ein entsprechendes Schreiben an den Ministerpräsidenten.
Am Tag darauf, dem 16. Juni, erklärten SED-Funktionäre den Bauarbeitern auf den verschiedenen Baustellen erneut, dass eine Rücknahme der Normerhöhungen nicht möglich sei. Daraufhin bildete sich auf der Stalinallee ein erster Demonstrationszug, dem sich viele Arbeiterinnen und Arbeiter anschlossen. Sie forderten auf Plakaten die Senkung der Normen und zogen in das Stadtzentrum.
Der Demonstrationszug wuchs schnell an und auch Arbeiterinnen und Arbeiter in anderen Betrieben traten in den Streik und demonstrierten. Gegen 13:30 Uhr kamen die ersten Demonstranten am Haus der Ministerien an. Schließlich waren dort ca. 10.000 Demonstranten versammelt. Um diese Zeit berichtete erstmals der amerikanische RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) über die Demonstrationen im Ostteil der Stadt.
Etwa um 14:00 Uhr erschien ein Minister der DDR-Regierung und verkündete den Demonstrierenden die Rücknahme der Normerhöhungen. Diese Nachricht interessierte die Menschen nun aber nicht mehr, denn mittlerweile forderten sie freie und geheime Wahlen. Gegen 14:30 räumten die Demonstranten den Platz; gleichzeitig riefen sie für den nächsten Tag einen Generalstreik aus.
Eine Abordnung der Demonstranten übergab dem RIAS eine Resolution mit der Bitte um Veröffentlichung. Der Sender, der in weiten Teilen der DDR gehört werden konnte, verlas die Forderungen in einer abgeschwächten Version. Schließlich informierte der RIAS spätabends darüber, dass alle Bürger und Bürgerinnen Ostberlins am Morgen des 17. Juni ab 7:00 Uhr zu einer Demonstration aufgerufen seien. Die Verantwortlichen des Senders wollten einerseits informieren, andererseits aber auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass sie die Unruhen anheizten. In der Bundesrepublik vermutete man zunächst, dass es sich bei den Demonstrationen um Maßnahmen der SED handele, um die Wiedervereinigung Deutschlands von östlicher Seite aus anzustoßen. Man wartete ab. Die SED ihrerseits veranstaltete am Abend des 16. Juni ab 20:00 Uhr in Berlin eine Veranstaltung, bei der sich die Parteigrößen feierten und die Ereignisse in der Stadt ignorierten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Ein Arbeiter steht auf einem Turmdrehkran.
2. Der 17. Juni in Berlin und in anderen Städten der DDR
Die Demonstrationszüge bewegten sich in allen Städten auf ähnliche Ziele zu: Haftanstalten, Dienststellen der Volkspolizei sowie Büros der Staatssicherheit (Ministerium für Staatssicherheit, MfS). Auch Gebäude von Stadtverwaltungen und der SED steuerten die Demonstranten an. Viele dieser Gebäude wurden gestürmt und von den Demonstrierenden verwüstet. Aus Haftanstalten in einzelnen Städten wurden politische Gefangene befreit. Polizisten wurden entwaffnet, Staatsbedienstete und SED-Funktionäre verprügelt. Vereinzelt kam es zu Schießereien. Polizeiwägen und einzelne Gebäude gingen in Flammen auf. Die Sicherheitskräfte der Volkspolizei und des MfS waren rasch überfordert und konnten die Aufstandsbewegung nicht stoppen. In über 700 Orten in der ganzen DDR kam es zu Streiks und Demonstrationen.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Menschen protestieren beim Juniaufstand 1953 vor dem Brandenburger Tor.
5. Die Bilanz des Aufstands
Das Besondere an dem Aufstand war, dass er sich spontan entwickelte und von keiner Organisation gesteuert wurde. Die Entscheidungen zur Beteiligung an den Protestaktionen fielen auf der Ebene einzelner Betriebe, in denen bei Streikveranstaltungen Streikleitungen gewählt wurden (fast überwiegend waren das Männer, der Frauenanteil lag bei 5%). Dann wurde über Forderungen und über die Beteiligung an Protestaktionen abgestimmt. Schon der Austausch zwischen einzelnen Betrieben erfolgte über Abgesandte, die sich persönlich von einem zum nächsten Betrieb auf den Weg machten. Da die Medien in der DDR die Proteste totschwiegen, war der Radiosender RIAS die einzige Informationsquelle, die von vielen DDR-Bürgern genutzt werden konnte. So gelangten die Informationen über die Proteste in Berlin nach und nach in alle Teile der DDR.
Überall forderten die Demonstrierenden den Rücktritt der Regierung, freie Wahlen und die Wiedervereinigung. Der Zorn der Menschen richtete sich gegen alle Einrichtungen von Staat und Partei, die als Symbole der Unterdrückung angesehen wurden. In vielen Städten war die Übermacht der Protestierenden enorm. Die staatlichen Kräfte (reguläre Volkspolizei, Kasernierte Volkspolizei und Mitarbeiter des MfS) waren den Massen nicht gewachsen. Erstaunlicherweise erlahmte fast überall die Bewegung, sobald die Protestierenden die Oberhoheit gewonnen hatten. Dann erschienen sowjetische Panzer und die Demonstrierenden wurden vertrieben. Im Nachhinein wurde den sowjetischen Soldaten ein vergleichsweise besonnenes Vorgehen attestiert, weil sie mit den Panzern langsam fuhren, um keine Menschen zu überrollen.
Die sowjetische Besatzungsmacht hatte über einen Großteil der DDR den Ausnahmezustand verhängt. Er wurde nach und nach aufgehoben, zuletzt in Leipzig am 11.Juli 1953.
Mehr als eine Million Menschen nahmen an den Demonstrationen und Streiks teil. Etwa 15.000 Menschen wurden verhaftet. 55 Todesopfer lassen sich aufgrund von Quellen mit Sicherheit nachweisen.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Flammen schlagen aus einem mehrstöckigen Gebäude aus.
Welche Auswirkungen hatte der Aufstand?
Welche Auswirkungen hatte der Aufstand?Die SED-Führung reagiert mit Zuckerbrot und Peitsche
Die sowjetischen Besatzer als auch die DDR-Führung reagierten zunächst mit aller Härte. In den Wochen nach dem Aufstand kam es weiter zu zahlreichen Verhaftungen. Die Verhafteten wurden zum Teil zu drakonischen Strafen verurteilt. Einige Menschen wurden sogar hingerichtet.
Nach den Ereignissen des 17. Juni baute die DDR-Führung den Sicherheitsapparat massiv aus, weil sie zukünftig nicht wieder von ähnlichen Protesten überrascht werden wollte.
Gleichzeitig machten Staats- und Parteiführung eine Reihe von sozialpolitischen Zugeständnissen.
1. Verhaftungen, Verurteilungen und Erschießungen
Nach der Niederschlagung des Aufstands gingen die Verhaftungen weiter. Die SED-Führung zeigte bei den von ihr angestrebten Prozessen große Härte bei der Bemessung der Strafen. Die DDR-Führung setzte einen eigenen Operativstab ein, der die Gerichte in den Bezirken der DDR anwies, eigene Strafsenate für den „17. Juni“ einzurichten. Die Urteile dieser Gerichte fielen vergleichsweise milde aus, wohl weil man weitere Unruhen in der Bevölkerung vermeiden wollte. Tatsächlich solidarisierten sich viele Menschen mit den Verhafteten und in einer Streikwelle im Juli 1953 forderten Arbeiter die Freilassung ihrer Kollegen. Die Machthaber lenkten ein und ließen zusätzlich weitere politische Urteile überprüfen. Es kamen bis Ende Oktober insgesamt 30.000 Menschen aus sowjetischen und aus DDR-Gefängnissen frei. Von den DDR-Gerichten wurden insgesamt etwa 1800 Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt. Die Sowjets verhängten und vollstreckten fünf Todesurteile, DDR-Gerichte vollstreckten zwei Todesurteile.
Aber nicht allein Verhaftungen und Verurteilungen trafen die Menschen. Wer sich an den Protesten beteiligt hatte, musste damit rechnen, seinen Arbeitsplatz zu verlieren und keinen neuen zu finden. Dann blieb nur noch die Flucht aus der DDR als Ausweg. Als Mitglied der SED mussten Menschen, die protestiert hatten, mit dem Ausschluss aus der Partei rechnen. Zahlen dazu, wie viele berufliche und private Lebenswege nachhaltig zerstört wurden oder wer unter Repressionen zu leiden hatte, gibt es keine.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Zwei Personen stehen an der Anklagebank zum 17. Juni.
2. Flucht als Ausweg
3. Der 17. Juni 1953 und die DDR-Führung
Um den Menschen entgegenzukommen, beschloss die SED eine Reihe von Maßnahmen: Die Normerhöhungen waren bereits rückgängig gemacht worden. Zusätzlich wurden die Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter erhöht und die Nahrungsmittelindustrie wurde zu Lasten der Schwerindustrie gefördert. In den HO-Geschäften (staatliche Einzelhandelsgeschäfte in der DDR) wurden die Preise für fast alle Waren um 10 bis 25 Prozent gesenkt.
Das Trauma des 17. Juni 1953 verfolgte die DDR-Führung bis zum Untergang ihres Staates. Deshalb wurde der Sicherheitsapparat massiv ausgebaut und die Bespitzelung der eigenen Bevölkerung in ungekannter Weise perfektioniert.
Um von den eigenen Fehlern abzulenken, suchte die SED die Schuld bei den westlichen Staaten:
„Feindliche Kräfte unter direkter Beteiligung und Führung amerikanischer Stellen und der Volksfeinde in Bonn organisierten in der Zeit vom 16. bis 22.6.1953 den Versuch eines faschistischen Umsturzes in der DDR.“
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Ein Lebensmittelgeschäft mit frischem Gemüse und anderen Auslagen.
4. Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der DDR
Die SED schloss alle Mitglieder aus der Partei aus, die sich am Aufstand beteiligt hatten; davon waren 26.416 Personen betroffen. Der Staatspartei war klar geworden, dass nur die Erhöhung des Lebensstandards, vor allem eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln, gegen die Unzufriedenheit der Bevölkerung helfen würde. Auch konnte so am ehesten die Tendenz zur Flucht in den Westen gebremst werden.
Damit die DDR-Führung nicht mehr als abhängig von Moskau erschien, gewährten ihr das Regime aus Moskau mehr politischen Gestaltungsspielraum. Dies und eine langsame Verbesserung der wirtschaftlichen Lage trugen zur allmählichen Konsolidierung der SED-Führung bei.
Dennoch ging die „Abstimmung mit den Füßen“ weiter. Jeden Monat verließen Tausende Menschen die DDR. Schließlich sah die DDR-Führung in Rücksprache mit den Sowjets keine andere Lösung mehr, als die Fluchtwege endgültig zu verschließen. Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer. Für DDR-Bürger war der Übergang aus dem Ostsektor der Stadt in die westlichen Sektoren jetzt nicht mehr möglich. Westberliner durften nur zeitweilig unter Auflagen zu Besuchen in den Ostteil der Stadt reisen.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Die Mauer an der Bernauer Straße im französischen Sektor.
Wie wurde an den Volksaufstand erinnert?
Wie wurde an den Volksaufstand erinnert? Wie wurde er gedeutet?Totgeschwiegen in der DDR, Feiertag in der Bundesrepublik
Wer dagegen in der DDR nur den Versuch unternahm, an den 17. Juni zu erinnern, musste mit konsequenter Verfolgung durch die Behörden und mit Strafe rechnen.
1. Erinnerung an den 17. Juni 1953 in der DDR
Offizielle Politik war es, das Ereignis totzuschweigen. So mussten alle Häftlinge, die wegen Teilnahme am Aufstand im Gefängnis gesessen hatten, sich bei ihrer Entlassung verpflichten, zukünftig über die Ereignisse zu schweigen. Für die DDR-Führung blieb der 17. Juni 1953 eine traumatische Erfahrung, die ihr Verhalten gegenüber der eigenen Bevölkerung auf Dauer prägte.
Besonders deutlich wird dies an einem Wortwechsel, der im Rahmen einer Dienstbesprechung in der MfS-Spitze am 31. August 1989 stattfand. Erich Mielke, der Minister für Staatssicherheit, stellte die Frage: „Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?“ Darauf antwortete der MfS-Oberst Dieter Dangrieß: „Der ist morgen nicht, der wird nicht stattfinden, dafür sind wir ja auch da.“
Es sollte sich in Kürze zeigen, dass Dangrieß sich in seiner Einschätzung getäuscht hatte. Erneut formierten sich in der ganzen DDR Demonstrationszüge, die das System letztlich zum Einsturz brachten. Die Staats- und Parteiführung konnte jetzt nicht mehr auf die Rückendeckung aus Moskau setzen, da Michail Gorbatschow in der Sowjetunion einen Reformprozess angestoßen hatte, der auch den Staaten in Ostmitteleuropa erlaubte, selbst über ihre Zukunft zu bestimmen.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Portaitbild von Otto Emil Franz Grotewohl, Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik
2. Erinnerung an den 17. Juni 1953 in der Bundesrepublik
Auf Initiative von Wilhelm Wolfgang Schütz (1951 bis 1957 Berater des Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen) und des SPD-Politikers Herbert Wehner wurde 1954 das Kuratorium "Unteilbares Deutschland" gegründet. Diese von Persönlichkeiten aus allen Bereichen des politischen und gesellschaftlichen Lebens unterstützte Organisation sollte den Willen der Bevölkerung zum Erreichen der Wiedervereinigung mobilisieren. Am 17. Juni organisierte das Kuratorium beispielsweise Staffelläufe, an denen Kinder und Jugendliche teilnahmen. Plakate erinnerten die Menschen daran, dass Deutschland unteilbar sei, etc.
Allen Bemühungen zum Trotz nahm das Interesse der Bundesbürger an den Feiern zum 17. Juni allmählich ab. Als 1961 schließlich die Mauer gebaut wurde, rückte eine mögliche Wiedervereinigung in weite Ferne. Die „neue Ostpolitik“ unter Willy Brandt führte dazu, dass ernsthaft erwogen wurde, den Feiertag ganz abzuschaffen. Es war paradox: In dem Teil Deutschlands, in dem der Aufstand stattgefunden hatte, durfte nicht daran erinnert werden. Und in dem Teil Deutschlands, der dem Aufstand nur zugeschaut hatte, erkannten viele nicht, warum sie sich an das Ereignis erinnern sollten.
Nach der Wiedervereinigung bestimmte der Bundestag den 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit, und der 17. Juni wurde stillschweigend als Feiertag abgeschafft.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Plakat der Bundeszentrale für Heimatdienst
Quelle: Hauptstaatsarchiv Stuttgart: J 153
Impressum
Impressum
Eduversum GmbH in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Aufarbeitung (BStA)
Eduversum GmbH
Taunusstraße 52
65183 Wiesbaden
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Kronenstraße 5
10117 Berlin
Redaktionelle Betreuung
Umgesetzt wird die Internetseite „Protest (er)zählt!“ durch die Eduversum GmbH.
Konzept, Projektleitung und Redaktion
Eduversum GmbH
Taunusstraße 52
65183 Wiesbaden
Vertretungsberechtigter
Michael Jäger (Geschäftsführer)
Konzept, Projektleitung und Redaktion
Frauke Hagemann (verantwortlich), Peter Wigand
E-Mail: info@eduversum.de
Fachliche Beratung
Bundesstiftung Aufarbeitung, Katharina Hochmuth
Kathrin Semechin, Dominik Pick
Autorenschaft
Martin Bredol
Layout & Comic
Anja Malz Grafikdesign
Programmierung
Pageflow (Codevise Solutions GmbH)
Rechtshinweis
Die Eduversum ist Anbieter im Sinne der §§ 18 Abs.2 MStV; 5 Abs. 1 TMG. Alle Inhalte dieser Internetseite wurden sorgfältig erarbeitet und recherchiert. Diese Informationen sind ein Service der Bundesstiftung Aufarbeitung (BStA) und der Eduversum GmbH. Alle Informationen dienen ausschließlich zur Information der Besucher/innen des Onlineangebotes. Im Übrigen ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Es wurde Wert daraufgelegt, zutreffende und aktuelle Informationen bereitzustellen. Gleichwohl können Fehler auftreten. Die Anbieter weisen darauf hin, dass die Informationen auf den Webseiten allgemeiner Art sind, die nicht auf die besonderen Bedürfnisse im Einzelfall abgestimmt sind. Die Anbieter übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Haftung für Inhalte
Die BStA und die Eduversum GmbH übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Dienste. Alle zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und zusammengestellt. Auf spätere Änderungen von unmittelbar verlinkten Seiten sowie auf Inhalte nachfolgender Seiten fremder Angebote haben wir jedoch keinen Einfluss. Wir distanzieren uns daher ausdrücklich von späteren Änderungen unmittelbar verlinkter Seiten, den Inhalten auf nachfolgenden Seiten sowie deren Anbietern.
Jede/-r Nutzer/-in bleibt selbst für die Überprüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen verantwortlich.
Copyright-Hinweis
Der Gebrauch der Inhalte der virtuellen Ausstellung im regulären Schulunterricht ist ausdrücklich erwünscht und erlaubt. Jede über den Gebrauch dieser Inhalte im Schulunterricht und die gesetzlich zulässigen Fälle (zum Beispiel das Zitatrecht oder Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch) hinausgehende Verwertung von urheberrechtlich geschützten Inhalten, insbesondere durch Vervielfältigung und Verbreitung auch in elektronischer Form, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Rechteinhaber.
Bildrechte
Screendesign: © Adobe Stock, iStock
Modul I: 17. Juni 1953 - Volksaufstand in der DDR
zeitzeugenportal.de
Bundesarchiv, Bild 183-20042-0001, Heinz Junge
Bundesarchiv / BArch, NY 4090/699 Bl. 30
Sächsisches Staatsarchiv, 13782 Sammlung Bewegtbilder, Nr. AV 13782-102
Bundesarchiv, Bild 183-20042-0003, Heinz Junge
ullstein Bild / ullstein Bild
Bundesarchiv, Bild 183-20027-0003, Heinz Junge
Bundesarchiv, Bild 183-20524-0002, Heinz Junge
Bundesarchiv / BStU, MfS, AU, Nr. 487/53, Bd. 16, Bl. 12
Akg-images / ddrbildarchiv.de
Bundesstiftung Aufarbeitung, Klaus Mehner, 72 0325
Alamy Stock Foto / World History Archive
Landesarchiv Baden-Württemberg / Hautstaatsarchiv Stuttgart J 153 Nr 539
Modul II: 1968 - Prager Frühling
Bridgeman Images / Archives Charmet
ullstein Bild / ADN-Bildarchiv
Tschechische Literaturbibliografie / Institut für tschechische Literatur CAS
Alamy Stock Foto / CTK
Tschechische Literaturbibliografie / Institut für tschechische Literatur CAS
Interfoto / ERB
Ullstein Bild / United Archives
Picture Alliance / akg-images / akg-images
Alamy Stock Foto / Keystone Press
Interfoto / Milon Novotny
Alamy Stock Foto / CTK
Alamy Stock Foto / CTK
Picture Alliance / CTK / Oldrich Picha
Alamy Stock Foto / Pictorial Press Ltd
Robert-Havemann-Gesellschaft/ HL 180
SZ Photo / Libor Hajsky / CTK Photobank
Alamy Stock Foto / CTK
Bundesarchiv / BStU, MfS, HA IX, Nr. 25453, Bl. 194
Picture Alliance / akg-images / akg-images
Modul III: Die 68er Bewegung
Picture Alliance / Klaus-Dieter Heirler / Klaus-Dieter Heirler
ullstein Bild / Gert Kreutschmann
Alamy Stock Foto / imageBROKER/klaus Rose
Bundesstiftung Aufarbeitung, Klaus Mehner, 68 0217
ullstein Bild / Alex Waidmann
ullstein Bild / dpa
Alamy Stock Foto / Shawshots
Bundesstiftung Aufarbeitung, Klaus Mehner, 68 0528
Bundesstiftung Aufarbeitung, Klaus Mehner, 68 0218
Bundesstiftung Aufarbeitung, Klaus Mehner, 68 0411
Alamy Stock Foto / Philippe Gras
Alamy Stock Foto / imageBROKER/klaus Rose
Alamy Stock Foto / Keystone Press
Bundesstiftung Aufarbeitung, Klaus Mehner, 68 0412
Ullstein Bild / dpa
Alamy Stock Foto / imageBROKER/klaus Rose
Picture Alliance / dpa / Klar
Picture Alliance / dpa / Lutz Rauschnick
Alamy Stock Foto / imageBROKER/klaus Rose
Historische EInführung
Zum Anfang1968 - "Prager Frühling"Historische Einführung
Die Partei- und Staatsführung unter Alexander Dubček in der Tschechoslowakei ging 1968 noch weiter und begann ihrerseits damit, einen Reformprozess in Gang zu setzen. Sie wollte mit den Veränderungen überkommene Strukturen aufbrechen und mit der Einführung von marktwirtschaftlichen Elementen die wirtschaftliche Situation des Landes verbessern. Auch der bisher offiziell weitgehend ignorierte Konflikt zwischen Tschechen und Slowaken sollte entschärft werden. Die Bevölkerung nahm die neuen Freiheiten mit großer Zustimmung auf. Aus einer sich neu formierenden Öffentlichkeit heraus wurden noch weiter gehende Reformmaßnahmen gefordert.
Die Sowjetunion und die angrenzenden sozialistischen Staaten betrachteten die Entwicklung in der Tschechoslowakei mit Sorge, denn sie befürchteten ein Ausgreifen der Reformwünsche auf die Bevölkerung in ihren Staaten. Nach mehreren Ermahnungen an die Adresse der tschechoslowakischen Partei- und Staatsführung beendeten nach nur gut einem halben Jahr Truppen des Warschauer Paktes, die in die Tschechoslowakei einmarschierten, den sogenannten „Prager Frühling“ mit Gewalt.
Anmerkung: Wenn von der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei die Rede ist, wird hier die Abkürzung des tschechischen Namens „Komunistická strana Československa“ (KSČ) genutzt. Im Deutschen sind auch die Abkürzungen KPT oder KPČ gebräuchlich.
Datenschutz
Datenschutz
Wir verpflichten uns zum Schutz aller personenbezogenen Daten wie auch zur Transparenz darüber, welche Daten wir über dich erfassen und zu welchem Zweck wir diese verwenden.
Um den neuesten Änderungen in der Datenschutzgesetzgebung auf Basis der am 25. Mai 2018 europaweit in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu entsprechen und unsere Verpflichtung zur Transparenz aufzuzeigen, haben wir unsere Datenschutzerklärung aktualisiert.
Am Umgang mit deinen Daten ändert sich dabei jedoch grundsätzlich nichts. Wenn du genauere Einzelheiten erfahren möchtest, schaue dir unsere Datenschutzrichtlinien an unter:
https://eduversum.de/impressum/
Kontaktadresse für datenschutzrelevante Anfragen:
info@eduversum.de
Was waren Ursachen und Auslöser der Reformpolitik?
Was waren Ursachen und Auslöser der Reformpolitik, die ab 1968 in der ČSSR einsetzten?Im Schatten der Vergangenheit
Mit diesen Maßnahmen sollte jede Opposition im Land erstickt werden. Als nach dem Tod Stalins in anderen Staaten des Ostblocks behutsam ein „Neuer Kurs“ beschritten wurde, gab es vonseiten der KSČ nur halbherzige Schritte in Richtung Entstalinisierung. Erst in den 1960er-Jahren, etwa anderthalb Jahrzehnte später, begann die Rehabilitierung der Opfer im Rahmen einer vorsichtigen Liberalisierung.
1. Die Schauprozesse der 1950er Jahre
Eine erste Überprüfung der Urteile fand im Jahr 1956 statt – auf Druck der Sowjetunion. Dort hatte Nikita Chruschtschow, der Vorsitzende der KPdSU, auf deren 20. Parteitag im Jahr 1956 zugegeben, dass die stalinistischen Schauprozesse ein Fehler gewesen seien. In der Tschechoslowakei hingegen wurden alle Urteile bestätigt, es gab nur wenige Strafmilderungen. Von der Überprüfung und dem Ergebnis erfuhr die Öffentlichkeit nichts. Innerhalb der KSČ nahmen kritische Stimmen zu. Funktionäre und einfache Parteimitglieder stellten die Rechtmäßigkeit der Prozesse in Frage. Es setzte ein Denkprozess ein, der sich nicht mehr stoppen ließ.
Erst 1963 kam eine neue Kommission zu dem Ergebnis, dass es die angebliche Verschwörung nie gegeben hatte; die Urteile wurden aufgehoben. Dennoch wurden die Opfer nicht voll rehabilitiert. Als die Öffentlichkeit von der Aufhebung der Urteile erfuhr, kamen viele Fragen auf, u. a. nach der Rolle der Parteifunktionäre, die seinerzeit die Urteile verteidigt hatten und noch immer leitende Funktionen innehatten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Der Schauprozess gegen Rudolf Slánský und weitere führende Parteifunktionäre.
2. Die politische und wirtschaftliche Situation in der ČSSR in den 60er Jahren
Im Jahr 1956, als es in Polen und Ungarn große Aufstände gegen die herrschenden Parteien gab, blieb es in der Tschechoslowakei ruhig. Generalsekretär der KSČ war seit 1953 Antonín Novotný; ab 1957 war er zudem Präsident der Tschechoslowakei. Er war mitverantwortlich für die Politik der Schauprozesse und verzögerte nach Kräften eine Entstalinisierung in seinem Land. Erst zu Beginn der 1960er-Jahre schwenkte er um und berief angesichts einer Wirtschaftskrise reformwillige Parteimitglieder in das Zentralkomitee der KSČ.
Wirtschaftlich war es in den 1950er-Jahren aufwärts gegangen. 1961 und 1962 brach die Wirtschaftsleistung plötzlich ein. Auf dem 12. Parteitag der KSČ 1962 beschwor die Partei den Sieg des Kommunismus mithilfe einer wissenschaftlich-technischen Revolution. Jetzt konnte der Wirtschaftswissenschaftler Ota Šik die Parteiführung überzeugen, dass der Ausweg aus der Krise in der Einführung von marktwirtschaftlichen Elementen in das System der Planwirtschaft liege. 1963 wurde eine Kommission eingesetzt, die Wirtschaftsreformen vorschlagen sollte. 1966 beschloss die KSČ die beschleunigte Einführung der Pläne dieser Kommission.
Im Zuge der Diskussionen um die Rolle der Schauprozesse setzte die Partei 1966 eine weitere Kommission ein, die unter der Leitung von Zdeněk Mlynář ein Konzept der Demokratie in der sozialistischen Gesellschaft erarbeiten sollte.
Šik und Mlynář erhielten bei Parteiveranstaltungen große Zustimmung für ihre Reformpläne und verbreiteten so ihre Ideen. Obwohl die Dringlichkeit von Reformen von einem Großteil der Bevölkerung und der Parteifunktionäre erkannt wurde, bremste die Führung der KSČ unter Antonín Novotný weiter.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Unterzeichung der neuen Verfassung der CSSR, 1960.
3. Schriftsteller*innen und Intellektuelle - das Gewissen der Nation?
In den 1960er-Jahren wurden ihre Forderungen lauter. Die tschechischen und slowakischen Schriftsteller verbaten sich staatliche Einmischung in ihre Verbände und forderten Meinungsfreiheit. Ihre Verbandszeitschriften entwickelten sich zu Sprachrohren unterdrückter Meinungen. Nach und nach verschoben sie die Grenzen des Erlaubten zu ihren Gunsten.
Auf dem 4. Tschechoslowakischen Schriftstellerkongress im Juni 1967 kritisierte der Journalist Ludvík Vakulík die politische Entwicklung der letzten 20 Jahre, weil sie zu einer völligen Demoralisierung der Menschen geführt habe. Für diese Äußerungen, die eine massive Kritik am bestehenden System darstellten, wurde er (wie auch andere, so z. B. Pavel Kohut und Ivan Klima) aus der Partei ausgeschlossen. Die KSČ schlug einen härteren Kurs gegenüber den Schriftsteller*innen ein.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Die erste Ausgabe von „Literární Listy“ erschien am 1. März 1968. Die Überschrift lautet: "Vernunft und Gewissen".
Die Quelle wurde mit freundlicher Unterstützung von der Tschechischen Litaraturbibliografie zur Verfügung gestellt. Sie stammt aus dem Digitalen Zeitschriftenarchiv, betrieben vom Institut für tschechische Literatur des CAS, online abrufbar unter: https://clb.ucl.cas.cz/ (ORJ-Code: 90243, hier unter: https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitL/1.1968/1/1.png.
4. 1967: Studierende demonstrieren gegen die bestehenden Verhältnisse
Ab etwa 1963 entwickelte sich in Prag und anderen Universitätsstädten eine oppositionelle Studentenszene.
Am 31. Oktober 1967 feierte das Zentralkomitee (ZK) der KSČ auf der Prager Burg den 50. Jahrestag der Oktoberrevolution. Zur gleichen Zeit demonstrierten auf der Prager Kleinseite Studierende, die bessere Lebensbedingungen im Rahmen ihres Studiums forderten. Der Protest wurde von der Polizei brutal niedergeschlagen. Eine Woche später forderten die Studierenden, dass die Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden, über die Vorgänge im Parlament debattiert und dass eine den Tatsachen entsprechende Berichterstattung in der Presse erfolgen solle. Sollten die Forderungen nicht erfüllt werden, drohten sie mit weiteren Protesten.
Die Partei reagierte zwiespältig: die Kritik an den Missständen sei berechtigt, aber die Demonstration sei kein passendes Mittel gewesen, um auf die Probleme hinzuweisen. Der ganze Vorgang solle noch weiter untersucht werden. Das Ganze stellte sich als Hinhaltetaktik heraus. Es zeigte sich, dass die Partei in einer Zwickmühle steckte: Einerseits unterdrückte sie die Proteste gewaltsam. Andererseits wollte sie die Studierenden, die als zukünftige Fachkräfte in der Wirtschaft dringend benötigt wurden, nicht verlieren.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
1965 hatte die KSČ den Studierenden in den Universitätsstädten erlaubt, ihren traditionellen Majales-Umzug zu veranstalten – das Foto zeigt den Umzug in Prag. Dabei ging es ein wenig wie im Karneval zu.
1968 - Prager Frühling
Zur Startseite
Welche Inhalte kennzeichneten die Reformpolitik der KSČ?
Welche Inhalte kennzeichneten die Reformpolitik der KSČ?Die KSČ beschreitet neue Wege
Innerhalb weniger Wochen änderte sich dieses Bild. Zwei einschneidende Ereignisse veränderten die politische Landschaft in der Tschechoslowakei: Am 4. März 1968 wurde die Zensur abgeschafft und am 5. April beschloss die KSČ ein Aktionsprogramm, das Reformen in allen Bereichen von Partei und Staat festschrieb. Der Soziologe und Philosoph Radovan Richta umschrieb die angestrebten Veränderungen mit der später häufig zitierten Formulierung als „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“.
1. Erste Signale einer sich wandelnden Politik der KSČ
Tatsächlich gab es erste Anzeichen für Veränderungen. Die Zeitschrift „Literární noviny“ war wegen ihrer kritischen Artikel im September 1967 auf Beschluss des ZK der KSČ dem Schriftstellerverband entzogen und dem Ministerium für Kultur und Informationen unterstellt worden. Ab dem 29. Februar 1968 durfte sie unter dem Namen „Literární Listy“ wieder in der Verantwortung des Schriftstellerverbands erscheinen.
Für aufmerksame Beobachter war dies ein deutliches Signal dafür, dass keine Zensur mehr ausgeübt wurde. Innerhalb kürzester Zeit verwandelten sich die Zeitungen und Zeitschriften des Landes in Medien, die informierten und aufklärten, anstatt Meldungen der Partei zu veröffentlichen. Es gab aber im ZK der KSČ auch eine Gruppe von Parteimitgliedern, die den Wechsel in der Parteiführung als „Putsch bourgeoiser Elemente“ bezeichneten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Die erste Ausgabe von „Literární Listy“ erschien am 1. März 1968. Die Überschrift lautet: "Vernunft und Gewissen".
Die Quelle wurde mit freundlicher Unterstützung von der Tschechischen Litaraturbibliografie zur Verfügung gestellt. Sie stammt aus dem Digitalen Zeitschriftenarchiv, betrieben vom Institut für tschechische Literatur des CAS, online abrufbar unter: https://clb.ucl.cas.cz/ (ORJ-Code: 90243, hier unter: https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitL/1.1968/1/1.png.
2. Die Flucht von General Šejna und die Folgen
Auf Staatspräsident Novotný fiel ein dunkler Schatten. Jetzt wurde ihm auch u. a. seine Verantwortung für die Schauprozesse der 1950er-Jahre angelastet. Es war offensichtlich, dass er seinen Posten räumen musste. Am 22. März trat er von seinem Amt zurück.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Portraitbild von General Jan Šejna, Oberster Politoffizier der Tschechoslowakischen Volksarmee
4. Die neue Politik und die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger
Auch bei den traditionellen Feiern zum 1. Mai 1968 war deutlich sichtbar, was sich bereits geändert hatte. Es kamen weit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in den vergangenen Jahren. Sie wirkten erfreut und bekräftigten damit den eingeschlagenen Weg der Parteiführung. Neben offiziellen Transparenten kamen selbstgemalte Plakate zum Vorschein, wie eines, auf dem zu lesen war: „Zum ersten Mal freiwillig!“ Dies zeigte, dass man bisher zur Teilnahme an den Feierlichkeiten verpflichtet war. Auf anderen Transparenten las man: „Pressefreiheit“ oder auch „Rehabilitation“.
Am 4. Mai organisierten Studierende eine weitere Demonstration, an der rund 3.000 Studierende teilnahmen. Sie forderten mehr Demokratie und das Ende des Machtmonopols der KSĆ. Es zeigte sich immer deutlicher, dass nicht mehr die Partei den Kurs vorgab, sondern dass die Öffentlichkeit zur treibenden Kraft der politischen Entwicklung geworden war.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Die von der KSĆ organisierte Parade zum 1. Mai 1968 wird angeführt (v.l.n.r.) vom stellvertretenden Ministerpräsident.
5. Wie weit können die Reformer in der KSĆ gehen?
Alle Schritte der Parteiführung in der Tschechoslowakei wurden aus Moskau und aus den sozialistischen "Bruderstaaten" kritisch beobachtet. Auch wenn im Aktionsprogramm vom 5. April 1968 der Zusammenhalt der sozialistischen Staaten beschworen wurde, reklamierte die KSĆ für die Tschechoslowakei einen eigenen Weg. Die KP-Chefs in Moskau, Warschau und in Ostberlin betrachteten schon die Aufhebung der Pressezensur als ein Warnsignal. Sie befürchteten, dass antisozialistische Kräfte die Oberhand gewinnen könnten. Im Gegensatz zu den Staats- und Parteiführungen in den sozialistischen Bruderstaaten reagierten viele Menschen dort zustimmend auf die Veränderungen in der Tschechoslowakei.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Der Generalsekretär des ZK der KPdSU, Leonid Iljitsch Breschnew (Mitte), im Gespräch mit dem 1. Sekretär des ZK der polnischen KP, Wladislaw Gomulka (rechts), und dem Generalsekretär der SED Walter Ulbricht (links) (Foto um 1968).
Welche Forderungen stellten die Bürgerinnen und Bürger?
Welche Forderungen stellten die Bürgerinnen und Bürger?Die Gesellschaft gerät in Bewegung
Es entstand eine kritische Öffentlichkeit; die Kommunikation in der Gesellschaft verlief nicht mehr einseitig von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. So mussten sich Politiker jetzt bei Veranstaltungen den kritischen Fragen der Bürger stellen.
1. Die ersten Forderungen nach Veränderung kommen aus der Partei
Interessant ist, dass der Anstoß zu Veränderungen nicht gegen die Partei gerichtet war, sondern sich aus der KSĆ selbst entwickelte. Selbst die Verantwortlichen in den Medien gehörten der Partei an. In den öffentlichen Diskussionen wurden immer weitergehende Forderungen laut: nach demokratischen Grundrechten, nach Menschen- und Bürgerrechten wie Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder auch Reisefreiheit.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Der am 30. März 1968 neu gewählte tschechoslowakische Präsident Ludvik Svoboda (links) mit Alexander Dubček (rechts) auf der Prager Burg.
2. Massenversammlungen - eine neue Form von Öffentlichkeit
Man diskutierte über die politischen Prozesse der 1950er-Jahre, über die Rehabilitierung der Opfer, aber auch über die Zukunftsperspektiven des Landes. Eine der bekanntesten Massenveranstaltungen fand am 20. März in Prag in einem Kongresszentrum mit mehr als 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Sie dauerte sieben Stunden und wurde live im Fernsehen übertragen. Am Ende verabschiedete man eine Resolution, in der ein „wirklich aufgeklärter, humaner und demokratischer Sozialismus“ gefordert wurde. Freiheitsrechte sollten garantiert und eine Gewaltenteilung eingeführt werden.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Ota Šik, der Schöpfer der Wirtschaftsreformen des Prager Frühlings
3. Die Medien und die Demoskopie
In atemberaubendem Tempo verwandelten sich diese Printmedien von „Transmissionsriemen der Partei“ zu kritischen Medien, die investigativ recherchierten und Moral zum Maßstab ihres Handelns erhoben. Die Auflagenzahlen stiegen, weil die Menschen Neuigkeiten erfuhren und nicht mit Verlautbarungen der KSĆ abgespeist wurden. Ähnliches galt auch für Rundfunk und Fernsehen.
Neben den Medien spielten im Jahr 1968 Meinungsumfragen eine wichtige Rolle. Sie zeichneten ein realistisches Meinungsbild; so war erkennbar, wie die Bevölkerung auf die Veränderungsprozesse reagierte. Das staatliche „Institut für die Erforschung der öffentlichen Meinung“ war 1965 eingerichtet worden. Es arbeitete auf internationaler Ebene mit bedeutenden Einrichtungen, z. B. in der Bundesrepublik und den USA, zusammen.
Die Meinungsumfragen bestätigen eine hohe Zustimmung der Bevölkerung zu den eingeleiteten Reformen und zu Alexander Dubček. Da vom Amtsantritt Dubčeks bis zur Niederschlagung der Reformbewegung in der Tschechoslowakei keine Wahlen stattfanden, belegen allein die Ergebnisse der Demoskopie die Zustimmung zur Reformpolitik.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Alexander Dubček in einer Fernsehansprache vom 18. Juli 1968.
4. Neue und alte gesellschaftliche Gruppierungen melden sich zu Wort
Großen Zulauf erhielt der „Klub 231“ oder „K231“. Der Name bezog sich auf das Gesetz Nr. 231 „Zum Schutz der demokratischen Volksrepublik“ aus dem Jahr 1948. Es diente u. a. als Grundlage für die Prozesse der 1950er-Jahre. K231 war eine Vereinigung von Opfern politischer Unterdrückung und hatte im August 1968 schon 60.000 Mitglieder. Sie forderten eine völlige Rehabilitierung aller Opfer politischer Prozesse.
Der Klub Engagierter Parteiloser (KAN) verfolgte das Ziel eines demokratischen Sozialismus. Die Mitglieder von KAN waren aber misstrauisch der KSĆ gegenüber und forderten die unmittelbare Einführung der Versammlungs- und Koalitionsfreiheit. Erst wenn dieser Schritt vollzogen sei, könne man von einem demokratischen Wettbewerb der Parteien auf dem Weg zum Sozialismus sprechen.
Besonders heikel für die KSĆ war die Forderung von Sozialdemokraten, ihre Partei wieder zuzulassen und damit die Zwangsvereinigung von 1948 rückgängig zu machen. Die KSĆ befürchtete einerseits, dass sie dann ernsthafte Konkurrenz einer sozialistischen Partei bekäme, die ohne eine schmutzige Vergangenheit dastünde; andererseits musste sie auch die sozialistischen "Bruderstaaten" fürchten, die darin einen Akt von Konterrevolution sahen.
Das Thema Geschlechtergerechtigkeit spielte in den Diskussionen über Reformen keine wirkliche Rolle. Offiziell galt die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Der „Tschechoslowakische Verband der Frauen“ nutzte die neuen Freiheiten und stellte die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Damit wird aber nur deutlich, dass die Gleichheit der Geschlechter nur eine offizielle Floskel war.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Eine junge Frau verfolgt die Nachrichten in Prag 1968.
5. Das Dilemma der KSĆ
Die Forderung nach einer Opposition wurde auch in weiteren gesellschaftlichen Kreisen erhoben, so z. B. im April in der Zeitschrift „Literární Listy“ von Václav Havel. Er meinte, dass nur eine Opposition garantiere, dass der Regierung ein echtes Korrektiv gegenüberstehe. Havel war Schriftsteller und einer der Wortführer der nichtkommunistischen Intellektuellen. Nach der Revolution 1989 wurde er Staatspräsident der Tschechoslowakei.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Der tschechische Schriftsteller Vaclav Havel, der Schriftsteller Jan Benes und Benes' Anwalt Jaroslav Tous (von links nach rechts) auf dem Wenzelsplatz in Prag am 23. März 1968. Benes wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren vom kommunistischen Regime ins Gefängnis gesteckt, u. a. weil er in einer Exilzeitschrift Texte publiziert hatte.
Mit welchen Konsequenzen mussten die Beteiligten rechnen?
Mit welchen Konsequenzen mussten die Beteiligten rechnen?Das Ende des Prager Frühlings
1. Die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten werden ungeduldig
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Portaitbild von Leonid Iljitsch Breschnew, Generalsekretär der KPdSU.
2. Das "Manifest der 2000 Worte"
In kürzester Zeit meldeten sich 120.000 Unterstützerinnen und Unterstützer des Manifests. Zugleich sahen die Reformgegner im Land in dem Manifest ein Dokument der Konterrevolution. Leonid Breschnew rief noch am Tag des Erscheinens Alexander Dubček an und brachte seine Entrüstung über das Manifest zum Ausdruck.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Ein Schreibmaschinendurchschlag des Manifests der 2000 Worte.
Quelle: Robert-Havemann-Gesellschaft HL 180
3. Die sozialistischen Staaten formieren sich
Nachdem sich die Parteichefs der UdSSR und vier weiterer "Bruderstaaten" (ohne die ČSSR) in Warschau am 14./15. Juli getroffen hatten, ging ein weiterer dringlicher Brief in Prag ein, der von allen Teilnehmern des Treffens in Warschau unterschrieben war. Die Führung der KSČ wies in einem offenen Brief den Vorwurf zurück, in der ČSSR sei eine Konterrevolution im Gange. Anschließend kam es zu einem bilateralen Treffen zwischen den Parteiführungen aus der Sowjetunion und der Tschechoslowakei, das in Čierna nad Tisou vom 21.Juli bis 1. August stattfand. Die Delegation der KSČ verpflichtete sich dabei, die Kontrolle über die Medien wiederherzustellen. Froh darüber, den Bruch mit der Sowjetunion vermieden zu haben, kehrte die Delegation nach Prag zurück. Sie wusste nicht, dass die Invasion der "Bruderstaaten" bereits beschlossene Sache war.
Die Invasion von Truppen des Warschauer Paktes erfolgte in der Nacht vom 20. auf den 21. August. Im Rahmen der „Operation Donau“ besetzten sowjetische, polnische, bulgarische und ungarische Truppen die gesamte Tschechoslowakei.
Als Alexander Dubček vom Einmarsch erfuhr, war er völlig niedergeschlagen und erklärte: „Ich, der ich mein Leben der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gewidmet habe – mir tun sie so etwas an, das ist die Tragödie meines Lebens!“
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Jugendliche demonstrieren auf einen sowjetischen Panzer auf dem Wenzelsplatz in Prag und halten ein Schild in die Höhe, auf dem steht „Nur autorisiertes Personal – Zutritt strengstens verboten“
4. Die Bevölkerung leistet gewaltlosen Widerstand
Vielfach sah man an Hauswänden die Aufforderung gepinselt „Iwan go home!“ Andere Grafittis verglichen die Invasoren mit den Deutschen, die 1939 das Land okkupiert hatten.
Nachdem die Fernsehsender und der staatliche Rundfunk besetzt waren, sendete ein „freier Rundfunk“ noch eine Zeit lang von verschiedenen Stationen im Land auf unterschiedlichen Frequenzen, um die Bevölkerung weiter zu informieren. Sabotageakte begleiteten die Aktionen, z. B. leiteten Eisenbahner Züge der Invasoren absichtlich in falsche Richtungen. Der gewaltlose Widerstand war jedoch riskant: 108 Menschen wurden bis Ende 1968 getötet, rund 500 Menschen schwer und Hunderte leicht verletzt.
Die Verzweiflung der Menschen, vor allem der Jugendlichen, zeigte sich in der Aktion eines Einzelnen exemplarisch: Der 21-jährige Student Jan Palach zündete sich am 16. Januar 1969 auf dem Prager Wenzelsplatz selbst an aus Protest gegen die Okkupation seines Landes. Als er drei Tage später starb, begaben sich ca. 200.000 Menschen zum Wenzelsplatz; viele legten dort Kränze für ihn nieder.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Ein Mann übermalt in Liberec ein Hinweisschild mit weißer Farbe um die Invasionstruppen zu behindern (Foto, 21. August 1968).
5. Reaktionen in West und Ost auf die Niederschlagung des "Prager Frühlings"
Auch in der DDR verurteilten viele Menschen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes. Aus Stasi-Unterlagen weiß man, dass allein in Ostberlin an 389 Stellen 3528 Flugblätter verbreitet und an 212 Stellen 272 Graffitis gesprüht wurden, die sich gegen die Invasion richteten. Solche Unternehmungen waren sehr gefährlich, 63% der Urheber dieser Aktionen wurden gefasst.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Flugblatt von Bettina Wegner als Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings.
Quelle: Bundesarchiv: BArch, MfS, HA IX, Nr. 25453, Bl. 194
6. Der "Prager Frühling" wird abgewickelt
Dieser Plan scheiterte jedoch. Sowjetische Soldaten hatten Alexander Dubček und vier weitere Reformer aus der Führungsriege der KSČ verhaftet und in die Sowjetunion gebracht. Auf Vorschlag von Präsident Svoboda willigte die sowjetische Führung ein, Gespräche über das weitere Vorgehen zusammen mit den verhafteten Reformern um Alexander Dubček in Moskau zu führen.
Als Ergebnis dieser Gespräche wurden die tschechoslowakischen Politiker gezwungen, das „Moskauer Protokoll“ zu unterschreiben. Darin war festgehalten, dass in der Folgezeit alle Reformen rückgängig gemacht werden sollten. Weil die Bevölkerung weiter geschlossen hinter Dubček stand, hoffte man durch die Vereinbarung mit ihm ein Blutvergießen verhindern zu können. Die Alternative wäre die gewaltsame Einsetzung einer moskautreuen Regierung gewesen.
Nachdem Dubček die errungenen Freiheiten Schritt für Schritt wieder aufgehoben hatte, trat er am 17. April 1969 zurück. Sein Nachfolger wurde Gustáv Husák, der die Tschechoslowakei mit harter Hand regierte.
Viele Reformer wurden mit Berufsverboten belegt und mussten sich mit Hilfsarbeiterjobs durchschlagen. Die Partei wurde von allen reformerischen Kräften gesäubert, was bedeutete, dass ein Viertel aller Parteimitglieder ausgeschlossen wurde. In den Massenmedien, in der Armee, im Justizapparat, in den Hochschulen und in wissenschaftlichen Einrichtungen wurden die Personen, die zu den Reformern gezählt wurden, nach und nach entfernt. Zehntausende Menschen flohen aus der Tschechoslowakei in den Westen.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Alexander Dubček (links) mit Staatspräsident Ludvik Svoboda (Mitte) nach der Rückkehr aus Moskau in Prag (Foto, August 1968).
Historische EInführung
Zum AnfangDie 68er Bewegung
In den USA engagierten sich Weiße und Farbige im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung für gleiche Rechte für alle Bürger. Linke Studierende in den USA, in Großbritannien, Frankreich, Italien und in der Bundesrepublik forderten unter anderem ein Ende des Vietnamkrieges und den Rückzug der US-Soldaten aus dem Land. Die Proteste der Studierenden in der Bundesrepublik richteten sich auch gegen überkommene Strukturen an den Hochschulen und in der gesamten Gesellschaft, aber ebenso gegen die geplanten Notstandsgesetze. Auch in Japan protestierten Studierende gegen das autoritäre Bildungs- und Erziehungssystem.
Zum Verständnis der Proteste in der Bundesrepublik ist es wichtig, die internationalen Verbindungen der Protestierenden zu kennen. Die Generation der Studierenden im Jahr 1968 setzte sich durchweg aus jungen Menschen zusammen, die nach der NS-Diktatur und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen war. Die Eltern und Großeltern waren tief geprägt von autoritären Strukturen, von Regeln und Gewohnheiten, die sie für notwendig hielten und befolgten. Die Studierenden stellten diese Regeln in Frage.
Was waren Ursachen und Auslöser der Proteste 1968?
Was waren Ursachen und Auslöser der Proteste 1968?Die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik
1955 wurde der junge Staat weitgehend wieder souverän, trat in die NATO ein und schuf sich mit der Bundeswehr eine neue Armee. Adenauer hatte zielstrebig die Bindung an den Westen betrieben. Der erste Schritt dazu war die Gründung der Montanunion, aus der dann 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) hervorging.
1963 trat Adenauer zurück. Ihm folgte für kurze Zeit Ludwig Erhard als Kanzler. Nach Streitigkeiten zwischen CDU/CSU und der FDP zerbrach die Regierung 1966; CDU/CSU und die SPD bildeten angesichts der ersten Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik eine Große Koalition unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU), die im Bundestag über eine überwältigende Mehrheit verfügte. Einzig die FDP bildete mit 49 von 496 Abgeordneten die Opposition.
1. Die Entwicklung einer politisch bewussten Öffentlichkeit
1962 führte die "Spiegel-Affäre" erneut zu spontanen Protesten, vor allem von Studierenden und Gewerkschaften. Der damalige Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß warf dem "SPIEGEL" vor, in einem Artikel über ein NATO-Manöver geheime Unterlagen veröffentlicht zu haben. Als die Redaktionsräume von der Polizei besetzt und führende Mitarbeiter des "SPIEGEL" verhaftet wurden, protestierten unter anderem Journalistinnen und Journalisten dagegen. Die Protestierenden brachten ihre Befürchtung zum Ausdruck, die Meinungs- und Pressefreiheit sei in Gefahr. Linke und liberale Medien wie der „Stern“ oder die „DIE ZEIT“ verurteilten ebenfalls die aus ihrer Sicht überzogenen Maßnahmen des Staates gegen den "SPIEGEL".
In den 1960er-Jahren erhielten die Proteste immer mehr Zulauf. Sichtbar wurde dies unter anderem in den sogenannten Ostermärschen, die sich gegen die Aufrüstung mit Atomwaffen wandten. 1960 demonstrierten etwa 1.000 Menschen an unterschiedlichen Orten gegen die Gefahr eines Atomkrieges. 1964 nahmen bereits 100.000 Menschen teil, 1967 waren es 150.000.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Studierende demonstrieren am 02.11.1962 in München gegen die jüngsten Polizei-Maßnahmen in der „Spiegel“-Redaktion (Foto, 2. November 1962).
2. Die Kluft zwischen den Generationen
Viele junge Menschen ließen sich von der "Gammler-Kultur" inspirieren und trugen lange Haare und Parkas, um sich von der Generation der Eltern zu unterscheiden. Viele Eltern fühlten sich provoziert, wenn ihre Töchter sich kurze Miniröcke kauften.
Ein weiterer Grund für die Konflikte zwischen den Generationen war die Musik. Jugendliche begeisterten sich für Rock- und Beat-Rhythmen, z. B. für die Beatles oder die Rolling Stones. Vor allem die letztere Gruppe stand mit ihrem Sound für die Ablehnung des Geschmacks der Erwachsenengeneration. Ausgelassen zu der Musik zu tanzen verstanden viele Jugendliche als einen Ausdruck von Freiheit. Bewusst wandte sich die junge Generation von den strengen Konventionen, die ihre Eltern befolgten, ab.
Viele junge Menschen waren unzufrieden darüber, dass ihre Eltern Fragen nach der unmittelbaren Vergangenheit auswichen oder gar Sympathien für das NS-Regime äußerten nach dem Muster: „Früher herrschte noch Ordnung!“
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Zwei "Gammler" in München (Foto, 1969).
4. Die APO - eine Protestbewegung formiert sich
Die Notstandsgesetze wurden von vielen politisch engagierten Bürgern, vor allem aber von Studierenden heftig bekämpft, weil sie darin Eingriffe in ihre Bürgerrechte sahen. Die Kritikerinnen und Kritiker fanden in der sogenannten Außerparlamentarischen Opposition (APO) zusammen. Sie befürchteten, dass aufgrund der Notstandsgesetze die deutsche Demokratie autoritäre Züge annehmen würde. Den Kern der APO bildete der SDS, es beteiligten sich aber auch andere Hochschulorganisationen, sowie linke Intellektuelle und Künstler.
Innerhalb der Protestbewegung gab es kein einheitliches Programm, dem sich alle verpflichtet fühlten; es handelte sich um eine nicht organisierte Bewegung mit vielen verschiedenen Vorstellungen. Die APO fand spontan zu bestimmten Anlässen zusammen, z. B. bei Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg oder die Notstandsgesetze.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
In Bonn versammelten sich Tausende von Menschen, um zu demonstrieren.
6. 1968: Höhepunkt der Proteste
Vor allem die "Bild"-Zeitung hetzte immer wieder gegen die demonstrierenden Studierenden, insbesondere aber gegen Rudi Dutschke: „Stoppt den Terror der Jung-Roten jetzt!“ oder „Stoppt den roten Rudi jetzt!“ Die Empörung aufseiten der Protestbewegung war groß.
Völlig überraschend wurde Rudi Dutschke am Gründonnerstag, dem 11. April 1968, in Berlin auf offener Straße von dem Hilfsarbeiter Josef Bachmann niedergeschossen. Er überlebte den Anschlag schwer verletzt. Daraufhin erreichte über die Ostertage die Protestbewegung ihren Höhe- und Wendepunkt. Bei den Protesten gab es Parolen wie „Haut dem Springer auf die Finger!“ und „BILD hat mitgeschossen“. Es kam zu Straßenschlachten zwischen Protestierenden und der Polizei. Am Ostersonntag demonstrierten in über zwanzig Städten rund 50.000 Studierende. In München fanden ein Reporter und ein Student unter ungeklärten Umständen den Tod. In Berlin griffen gewaltbereite Teilnehmer*innen das Springerhochhaus und den Fuhrpark des Verlages mit Molotow-Cocktails an.
Um die Notstandsgesetze zu verhindern, protestierten über 40.000 Menschen am 11. Mai 1968 mit einem Sternmarsch auf Bonn (damals Sitz der Bundesregierung); der Protest hatte keinen Erfolg, denn am 30. Mai verabschiedete der Bundestag die Gesetze. Danach begann die APO auseinanderzufallen. Auch der SDS zerfiel; er löste sich am 21. März 1970 selbst auf.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Vietnamtribunal des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes in West-Berlin.
7. Eine letzte Eskalation der Gewalt symbolisiert das Ende
Aus provokativen Aktionen von Protestierenden war massive Gewalt geworden. Diese Entwicklung beschleunigte den Zerfall der Protestbewegung.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Straßenschlacht vor dem Berliner Landgericht am Tegeler Weg zwischen Jugendlichen und der Polizei anlässlich der Verhandlung gegen den Rechtsanwalt Horst Mahler: die Polizei setzt Wasserwerfer gegen Steine werfende Demonstranten ein (Foto, 04.11.1968).
Die 68er Bewegung
Zur Startseite
Welche Forderungen wurden gestellt?
Welche Forderungen wurden gestellt und inwiefern kommen darin demokratische Grundrechte zum Ausdruck?Die Auseinandersetzung um demokratische Grundrechte - der Auftakt der Protestbewegung
Diesen Vorfall nahmen Studierende zum Anlass, Mitbestimmung in den Organen der universitären Selbstverwaltung zu fordern. Sie wandten sich gegen die autoritäre Einstellung vieler Professoren, die bereits in der NS-Zeit gelehrt hatten.
Die Proteste weiteten sich aus und entwickelten eine eigene Dynamik. Im Wesentlichen ging es dabei um folgende Forderungen:
- Demokratisierung der Gesellschaft
- Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau
- Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung (freie Liebe etc.)
- Auseinandersetzung mit der NS-Zeit
- Keine Notstandsgesetze
- Ende des Krieges in Vietnam
- Meinungs- und Pressefreiheit
1. Demokratisierung der Hochschulen und der Gesellschaft
Mit Beginn der Protestbewegung im Jahr 1965 wurde die Forderung nach Partizipation auf der Grundlage neuer Hochschulgesetze an vielen Universitäten erhoben. Schon bald erhoben die Protestierenden auch Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen, wobei einige Stimmen auch die bewusste Durchbrechung der Spielregeln einer demokratischen Gesellschaft zur Erreichung dieser Ziele forderten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Zwei Studenten der Universität Hamburg demonstrieren gegen die Ernennung des Universitätsrektors mit dem Spruchband „Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren“; dahinter links der ehemalige Rektor Prof. Schöfer, rechts der neue Prof. Ehrlicher (Foto, 09.11.1967). – Die Nationalsozialisten verwendeten den Begriff „Tausendjähriges Reich“, um damit die Stabilität ihres Systems auszudrücken.
2. Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit
Die Protestbewegung an den Universitäten forderte angesichts zahlreicher Professoren an den Universitäten, die bereits während des Nationalsozialismus gelehrt hatten, eine Auseinandersetzung mit deren Vergangenheit. Auch die NS-Vergangenheit hochrangiger Politiker wie z. B. Bundeskanzler Kiesinger oder Bundespräsident Heinrich Lübke war in den Augen der Protestierenden ein Skandal. Sie forderten eine Entnazifizierung, sprich: den Rücktritt dieser Politiker.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Adolf Eichmann (NS-Kriegsverbrecher) bei seinem Prozess in Jerusalem.
3. Keine Einführung von Notstandsgesetzen
Die Kritiker*innen sahen in den geplanten Gesetzen Parallelen zur Weimarer Republik, die mithilfe von Notverordnungen von den Nationalsozialisten in eine Diktatur umgewandelt worden war. Eine mögliche Wiederholung dieser Entwicklung verstanden viele als Anstoß zum Engagement gegen die geplanten Gesetze. Vertreter der Studierenden, aus Wissenschaft, Kultur, Gewerkschaften und Kirchen kämpften gemeinsam gegen die Notstandsgesetze, weil sie ein mögliches Abdriften der Demokratie in eine Diktatur verhindern wollten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Im Zuge des Vorlesungsstreiks wegen der Notstandsgesetze besetzten Studierende das Seminargebäude und beschmierten dessen Wände mit Parolen.
4. Kampf gegen den Vietnamkrieg
Die USA, die auf keinen Fall zulassen wollten, dass das Land von Kommunisten regiert würde, griffen 1965 militärisch in den Konflikt ein. Immer mehr US-Soldaten – 1968 waren es über eine halbe Million Soldaten – kämpften gegen einen eigentlich unterlegenen Feind. Mit systematischen Flächenbombardements versuchten die US-Truppen, Nordvietnam in die Knie zu zwingen, was aber nicht gelang.
In den USA waren immer mehr Menschen der Ansicht, der Krieg sei moralisch nicht zu rechtfertigen und auch nicht zu gewinnen; sie forderten den Rückzug der Truppen. Sie hielten die Art der Kriegführung für verwerflich, weil sie vor allem die Zivilbevölkerung traf.
Die Proteste gegen den Vietnamkrieg wurden vor allem von Studierenden in den USA unterstützt, aber genauso von protestierenden jungen Menschen in Großbritannien, Frankreich oder der Bundesrepublik. Als heuchlerisch empfanden es viele Menschen, dass die westlichen Staaten gegen die autoritären Regierungen des Ostblocks wetterten, andererseits die USA aber in Südvietnam ein autoritäres Regime unterstützten. Bei den Protesten der Studierenden in der Bundesrepublik war der Kampf gegen den Vietnamkrieg stets ein wichtiges Thema.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Demonstrationszug auf dem Kurfürstendamm.
5. Auseinandersetzung mit der Springer-Presse
Als begabter Redner trat Rudi Dutschke als ein Wortführer der Protestbewegung auf und war ein gesuchter Interviewpartner in den Medien.
Ganz anders verhielten sich die Boulevardmedien des Springer Verlags, zu denen z. B. die "Bild"-Zeitung und die "BZ" (eine Berliner Tageszeitung) gehörten. Die Springer-Gruppe hatte 1967/1968 bundesweit einen Marktanteil in Höhe von 33% bei den Printmedien, die neben Radio und Fernsehen das wichtigste Medium darstellten. Vor allem die "Bild"-Zeitung gab vor, für das „gesunde Volksempfinden“ zu sprechen. Sie bezeichnete Rudi Dutschke als „Bürgerschreck“ oder „Kommunistenführer“ und baute ihn zu einer Hassfigur auf.
Die "Bild"-Zeitung stachelte den Konflikt zwischen der jungen und der älteren Generation bewusst an und warnte vor einer Machtübernahme der neuen Linken unter ihrem Anführer Rudi Dutschke.
Die Studierenden wehrten sich und forderten unter dem Motto „Enteignet Springer!“ eine Entflechtung des Medienmarktes, weil nur so die Meinungs- und Pressefreiheit auch in Zukunft garantiert sei. Die Spannungen zwischen den Springer Medien und den Protestierenden nahmen zu. Als dann Rudi Dutschke das Attentat eines vermutlich Rechtsgesinnten nur knapp überlebte, kam es zu großen Demonstrationen und teilweise gewaltsamen Aktionen gegen Einrichtungen der Springer-Gruppe.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Demonstrierende versammeln sich vor dem Verlagshaus des Springer Verlags.
6. Kampf gegen alles Autoritäre
Innerhalb der Protestbewegung gab es Versuche, völlig neue Lebensformen auszuprobieren, um so eine bessere Gesellschaft zu erreichen. Die Kommune I in Berlin wurde Anfang 1967 von vier Männern und vier Frauen gegründet. Sie stellte die Ehe als Lebensform in Frage, weil ihrer Meinung nach aus den Abhängigkeiten von Mann und Frau in der Ehe der Faschismus entstünde. In der Kommune sollten alle alles miteinander teilen; es sollte keinen Privatbesitz mehr geben, auch keine festen Zweierbeziehungen. Die Kommunarden wollten liebende Menschen werden und mit Liebe die Welt verändern. Sie ähnelten dabei den Anhängern der Hippie-Bewegung in den USA, die unter dem Motto „Make love not war“ u a. gegen den Vietnamkrieg protestierten.
Die Mitglieder der Kommune machten immer wieder mit provozierenden Aktionen im Rahmen von Protestveranstaltungen auf sich aufmerksam. Der SDS schloss die Mitglieder der Kommune aus, weil immer mehr nur das Interesse der Medien auf sich ziehen wollten. Das Experiment endete im November 1969, als sich die Kommune offiziell auflöste.
Die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, ein antiautoritärer Umgang miteinander – das waren Forderungen in der Protestbewegung. Die Realität sah jedoch anders aus, denn den Frauen blieb meistens die Arbeit, während die Männer diskutierten. Erst 1968 bildeten sich Frauen- und Weiberräte in Berlin, Frankfurt und anderen Universitätsstädten, die sich für die Befreiung der Frauen einsetzten. Und es wurden die ersten Kinderläden gegründet, in denen Kinder antiautoritär erzogen wurden.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Zwei Studierende, davon einer mit einem Peace-Symbol auf dem Mantelrücken, stehen Polizisten bei einer Demonstration gegen den Vietnam-Krieg gegenüber.
Wer nahm an der Bewegung teil? Mit welchen Mitteln wollten sie Veränderungen erreichen?
Wer nahm an der Bewegung teil und mit welchen Mitteln wollten sie Veränderungen erreichen?Die Gesellschaft gerät in Bewegung
Vor allem der Auschwitz-Prozess, der von 1963 bis 1965 dauerte, lenkte das öffentliche Interesse auf die Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Auseinandersetzung mit dieser unmittelbaren Vergangenheit war für viele Menschen das Triebfeld, sich zu engagieren, und sich z. B. bei Demonstrationen für das demokratische Gemeinwesen einzusetzen. Bei den Ostermärschen gegen Atomwaffen in Europa oder bei den Aktionen gegen die Notstandsgesetze fanden zeitweilig sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen in der Außerparlamentarischen Opposition (APO) zusammen. Allerdings wollte die Mehrheit der Gesellschaft das dunkle Kapitel des Nationalsozialismus lieber abschließen und es nicht weiter thematisieren.
1. Beteiligte an den Protesten
Auch als sich die Proteste ausweiteten und sich die Protestierenden für eine andere Gesellschaft aussprachen, gegen den Vietnamkrieg oder gegen die Springer-Presse demonstrierten, stellten Studierende und Jugendliche (Schüler/Schülerinnen, Auszubildende) bei den Protesten mit Abstand die größte Gruppe; das war z. B. in Frankreich anders, wo die Proteste gegen die Regierung auch von Industriearbeiter*innen mitgetragen wurden.
Erst bei den Protesten gegen die Notstandsgesetze zogen im Rahmen der APO Studierende, Professor*innen, Gewerkschaften und sogar Kirchenvertreter*innen in der Bundesrepublik an einem Strang. Auch die Ostermärsche mobilisierten ein breites Spektrum von Beteiligten, die gegen Atomwaffen in Ost und West in Europa demonstrierten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Mehrere hundert Christen, darunter kirchliche Würdenträger im Gewand, demonstrierten 1968 in Bonn gegen die Notstandsgesetze.
2. "Widerstand in Protest überführen!"
Die Bewegung setzte auf ganz neue Protestformen : ziviler Ungehorsam und symbolische Gewaltaktionen in Form von Sitzblockaden, Besetzung von Unis und Teach-ins (Aufklärungsveranstaltung zu einem polarisierenden Thema), Sit-ins (Sitzstreik) oder Happenings (improvisiertes Ereignis im Zusammenspiel mit dem Publikum). In West-Berlin organisierten Studierende zu Beginn des Wintersemesters 1967 eine „Kritische Universität“, in der sie die von ihnen geforderte Studienreform selbst in die Hand nehmen wollten.
Die Protestbewegung veranstaltete auch Debatten und nutzte kulturelle Ausdrucksformen wie Theater, Musik oder sonstige Events für ihre Belange.
Innerhalb kurzer Zeit radikalisierte sich die Protestbewegung. Wurden 1967 noch Reformen im Rahmen der bestehenden Ordnung gefordert, waren 1968 Forderungen nach einer gänzlich neuen Politik und einem ganz anderen Leben zu hören. Die Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Protestierenden wurden zunehmend heftiger und es kam zu militanten Aktionen vonseiten der Protestierenden, z. B. bei den Anti-Springer-Protesten nach dem Attentat auf Rudi Dutschke.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Eine Gruppe trifft sich, um Vorbereitungen für den "Vietnam-Kongress" zu beschließen.
3. Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der Forderungen
Auch Rudi Dutschke hielt gezielte, illegale Provokationen im Rahmen der Proteste für gerechtfertigt, verurteilte aber Gewalt gegen Menschen. Andererseits betrachtete er die gewaltsamen revolutionären Bewegungen in der Dritten Welt als legitim.
Die zunehmende Radikalisierung und Gewalttätigkeiten bei den Protesten wurden von einem Großteil der Protestierenden abgelehnt. Letztlich zerbrach die Protestbewegung auch an der ambivalenten Einstellung zur Gewalt.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Wasserwerfer werden gegen Demonstrierende angewandet.
4. Was wurde aus den Beteiligten?
Der Weg von Ensslin und Baader stellt eine Ausnahme dar. Etliche Mitglieder des SDS wanderten in diverse K-Gruppen ab, wie z. B. die Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML) oder den Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW). Andere gründeten die DKP, die sich an der Politik der realsozialistischen Staaten DDR oder Sowjetunion orientierte und von der DDR unterstützt wurde.
Wieder andere begannen den „Marsch durch die Institutionen“ und traten in die SPD ein, um auf diese Weise politische Veränderungen zu erreichen. Andere engagierten sich später bei den Grünen.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Urteilsverkündung im Kaufhaus-Brandstifterprozess vor dem Landgericht in Frankfurt am Main. Auf der Anklagebank der Strafkammer v.l.n.r. Thorwald Proll, Horst Söhnlein, Andreas Baader und Gudrun Ensslin (Foto, 31.10.1968).
5. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Proteste
Dem stand ein großer Teil der Bevölkerung gegenüber, der keinerlei Verständnis für die Protestierenden hatte. Diese Menschen waren stolz auf ihre Leistungen beim Wiederaufbau und erfreuten sich an ihrem wachsenden Wohlstand. Sie sahen keinen Anlass für Veränderungen und waren mit der Politik der Bundesregierungen unter Führung der CDU zufrieden. Geradezu entsetzt reagierten sie, als sich die Proteste und die Forderungen der Protestierenden radikalisierten. Marxistische Positionen hatten für die breite Bevölkerung immer den Beigeschmack der realsozialistischen Staaten, wie etwa der DDR oder der Sowjetunion. Diese Gesellschaftsmodelle wurden von ihnen vehement abgelehnt.
Auch linke und liberale Medien, die bestimmten Forderungen der Protestbewegung offen gegenüberstanden, wandten sich angesichts der Radikalisierung von ihr ab.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Internationale Vietnamkongress und die anschließende Demonstration durch Studierende der Technischen Universität Berlin.
Welche Folgen hatten die Proteste?
Welche Folgen hatten die Proteste und welche Bedeutung haben sie für die Geschichte der Bundesrepublik?Die Protestbewegung im Zuge der Reformära der 1960er-Jahre
1. Unmittelbare Folgen der Protestbewegung
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) löste sich im März 1970 auf. Es bildeten sich kommunistisch orientierte Splittergruppen und die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), die auf der politischen Bühne ein Schattendasein führten.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
„Nieder mit Imperialismus und Reaktion, Es lebe die proletarische Weltrevolution“ steht auf einem roten Spruchband, das Demonstranten an der Spitze eines Protestzuges führen.
2. Die Protestbewegung und ihre Bedeutung für die politische Entwicklung der Bundesrepublik
Die neuen Protestformen etablierten sich und wurden bei politischen Auseinandersetzungen weiterhin eingesetzt.
Nach einer anfänglich totalen Blockade vonseiten der Professor*innen setzte ein Prozess der Demokratisierung an den Hochschulen ein. Die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt verfolgte ab 1969 unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen!“ eine Politik der gesellschaftlichen Reformen. Bürger und Bürgerinnen nahmen Partizipation ernst und gründeten z. B. Bürgerinitiativen.
Proteste gegen Großprojekte wie etwa gegen ein geplantes Kernkraftwerk in Whyl in den 1970er-Jahren waren bis dahin undenkbar. Die Proteste führten zum Erfolg: das Kraftwerk wurde nicht gebaut. Aktivisten aus der Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung, der Friedensbewegung und Anhänger der neuen Linken gründeten 1980 die Partei „Die Grünen“, die sich dauerhaft im Parteiengefüge etablierte.
Was ist auf dem Hintergrundbild zu sehen?
Mehrere hundert Polizisten räumten am 20. Februar 1975 das Gelände des geplanten Kernkraftwerks in Whyl. Badische und elsässische Umweltschützern hatten das Baugelände besetzt und leisteten gewaltlos Widerstand.
3. Waren die Veränderungen nach dem Ende der Bewegung von Vorteil?
Argumente der Verfechter*innen der 1968er
- Mittel- und langfristig wurden in den 1960er-Jahren Modernisierungsprozesse in Gang gesetzt, die auch auf die Protestbewegung zurückgeführt werden können.
- Die Mentalitätsstrukturen änderten sich: der obrigkeitsstaatlich orientierte Bürgerinnen und Bürger entwickelte sich zu einem selbstbestimmten Individuum.
- Frauen organisierten sich und setzten sich für mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft ein; dies führte langfristig zu einer veränderten Rollendefinition von Männern und Frauen in Beziehungen und auch zur Akzeptanz alternativer Paarbeziehungen ohne Trauschein.
- Die Einstellung zur Sexualität wandelte sich, sexuelle Verhaltensnormen lockerten sich.
- Langfristig wurden andere Lebensformen (Homosexuelle, Trans und Queere) aus der Illegalität geholt und in der Gesellschaft nach und nach akzeptiert.
- Eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit setzte ein.
Argumente der Gegner der 1968er
- Die 68er hatten unklare Vorstellungen von einer zukünftigen Gesellschaft, schafften es aber dennoch, ihre marxistisch geprägten Ideen salonfähig zu machen.
- Bisherige Autoritäten wie Elternhaus, Kirche oder Schule wurden in Frage gestellt und damit funktionierende soziale Bindungen zerstört – zugunsten einer Selbstverwirklichung des Individuums. Die damals propagierte antiautoritäre Erziehung führte nach Ansicht ihrer Kritiker zu einer Missachtung von Ordnung, Rücksichtnahme und Gemeinschaftsgefühl.
- Mit ihrer unentschiedenen Haltung zur Gewalt akzeptierten Teile der 68er Straßenkämpfe, bei denen zahlreiche Menschen verletzt wurden.
- Die teilweise mit Intoleranz geführten Debatten, z. B. an Hochschulen, vergifteten das politische Klima.
Frauen und Männer demonstrierten in Bonn.





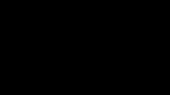
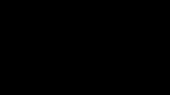

























































 Startseite
Startseite
 Comic
Comic
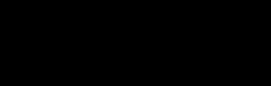 Was waren Ursachen und Auslöser des Volksaufstands 1953?
Was waren Ursachen und Auslöser des Volksaufstands 1953?
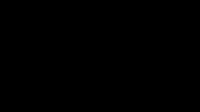 1. Die 2. Parteikonferenz der SED 1952 - planmäßiger Aufbau des Sozialismus
1. Die 2. Parteikonferenz der SED 1952 - planmäßiger Aufbau des Sozialismus
 2. Die wirtschaftliche und politische Situation der DDR
2. Die wirtschaftliche und politische Situation der DDR
 Fluchtbewegungen aus der DDR
Fluchtbewegungen aus der DDR
 3. Die Erhöhung der Arbeitsnormen
3. Die Erhöhung der Arbeitsnormen
 4. Der Tod Stalins und die Folgen
4. Der Tod Stalins und die Folgen
 5. Die Kurskorrektur der SED kommt zu spät
5. Die Kurskorrektur der SED kommt zu spät
 Übersicht Modul I
Übersicht Modul I
 1. Der Beginn des Aufstandes in Berlin
1. Der Beginn des Aufstandes in Berlin
 Resolution der Demonstration in Ostberlin am 16. Juni 1953
Resolution der Demonstration in Ostberlin am 16. Juni 1953
 2. Der 17. Juni in Berlin und in anderen Städten der DDR
2. Der 17. Juni in Berlin und in anderen Städten der DDR
 5. Die Bilanz des Aufstands
5. Die Bilanz des Aufstands
 1. Verhaftungen, Verurteilungen und Erschießungen
1. Verhaftungen, Verurteilungen und Erschießungen
 Urteil des Stadtgerichts Berlin
Urteil des Stadtgerichts Berlin
 3. Der 17. Juni 1953 und die DDR-Führung
3. Der 17. Juni 1953 und die DDR-Führung
 4. Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der DDR
4. Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der DDR
 1. Erinnerung an den 17. Juni 1953 in der DDR
1. Erinnerung an den 17. Juni 1953 in der DDR
 2. Erinnerung an den 17. Juni 1953 in der Bundesrepublik
2. Erinnerung an den 17. Juni 1953 in der Bundesrepublik
 Comic
Comic
 1. Die Schauprozesse der 1950er Jahre
1. Die Schauprozesse der 1950er Jahre
 2. Die politische und wirtschaftliche Situation in der ČSSR in den 60er Jahren
2. Die politische und wirtschaftliche Situation in der ČSSR in den 60er Jahren
 3. Schriftsteller*innen und Intellektuelle - das Gewissen der Nation?
3. Schriftsteller*innen und Intellektuelle - das Gewissen der Nation?
 4. 1967: Studierende demonstrieren gegen die bestehenden Verhältnisse
4. 1967: Studierende demonstrieren gegen die bestehenden Verhältnisse
 Übersicht Modul II
Übersicht Modul II
 2. Die Flucht von General Šejna und die Folgen
2. Die Flucht von General Šejna und die Folgen
 4. Die neue Politik und die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger
4. Die neue Politik und die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger
 5. Wie weit können die Reformer in der KSĆ gehen?
5. Wie weit können die Reformer in der KSĆ gehen?
 1. Die ersten Forderungen nach Veränderung kommen aus der Partei
1. Die ersten Forderungen nach Veränderung kommen aus der Partei
 2. Massenversammlungen - eine neue Form von Öffentlichkeit
2. Massenversammlungen - eine neue Form von Öffentlichkeit
 3. Die Medien und die Demoskopie
3. Die Medien und die Demoskopie
 4. Neue und alte gesellschaftliche Gruppierungen melden sich zu Wort
4. Neue und alte gesellschaftliche Gruppierungen melden sich zu Wort
 5. Das Dilemma der KSĆ
5. Das Dilemma der KSĆ
 1. Die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten werden ungeduldig
1. Die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten werden ungeduldig
 2. Das "Manifest der 2000 Worte"
2. Das "Manifest der 2000 Worte"
 3. Die sozialistischen Staaten formieren sich
3. Die sozialistischen Staaten formieren sich
 4. Die Bevölkerung leistet gewaltlosen Widerstand
4. Die Bevölkerung leistet gewaltlosen Widerstand
 5. Reaktionen in West und Ost auf die Niederschlagung des "Prager Frühlings"
5. Reaktionen in West und Ost auf die Niederschlagung des "Prager Frühlings"
 6. Der "Prager Frühling" wird abgewickelt
6. Der "Prager Frühling" wird abgewickelt
 Comic
Comic
 1. Die Entwicklung einer politisch bewussten Öffentlichkeit
1. Die Entwicklung einer politisch bewussten Öffentlichkeit
 2. Die Kluft zwischen den Generationen
2. Die Kluft zwischen den Generationen
 4. Die APO - eine Protestbewegung formiert sich
4. Die APO - eine Protestbewegung formiert sich
 6. 1968: Höhepunkt der Proteste
6. 1968: Höhepunkt der Proteste
 7. Eine letzte Eskalation der Gewalt symbolisiert das Ende
7. Eine letzte Eskalation der Gewalt symbolisiert das Ende
 Übersicht Modul III
Übersicht Modul III
 1. Demokratisierung der Hochschulen und der Gesellschaft
1. Demokratisierung der Hochschulen und der Gesellschaft
 2. Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit
2. Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit
 3. Keine Einführung von Notstandsgesetzen
3. Keine Einführung von Notstandsgesetzen
 4. Kampf gegen den Vietnamkrieg
4. Kampf gegen den Vietnamkrieg
 5. Auseinandersetzung mit der Springer-Presse
5. Auseinandersetzung mit der Springer-Presse
 6. Kampf gegen alles Autoritäre
6. Kampf gegen alles Autoritäre
 1. Beteiligte an den Protesten
1. Beteiligte an den Protesten
 2. "Widerstand in Protest überführen!"
2. "Widerstand in Protest überführen!"
 3. Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der Forderungen
3. Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der Forderungen
 4. Was wurde aus den Beteiligten?
4. Was wurde aus den Beteiligten?
 5. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Proteste
5. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Proteste
 1. Unmittelbare Folgen der Protestbewegung
1. Unmittelbare Folgen der Protestbewegung
 2. Die Protestbewegung und ihre Bedeutung für die politische Entwicklung der Bundesrepublik
2. Die Protestbewegung und ihre Bedeutung für die politische Entwicklung der Bundesrepublik
 3. Waren die Veränderungen nach dem Ende der Bewegung von Vorteil?
3. Waren die Veränderungen nach dem Ende der Bewegung von Vorteil?